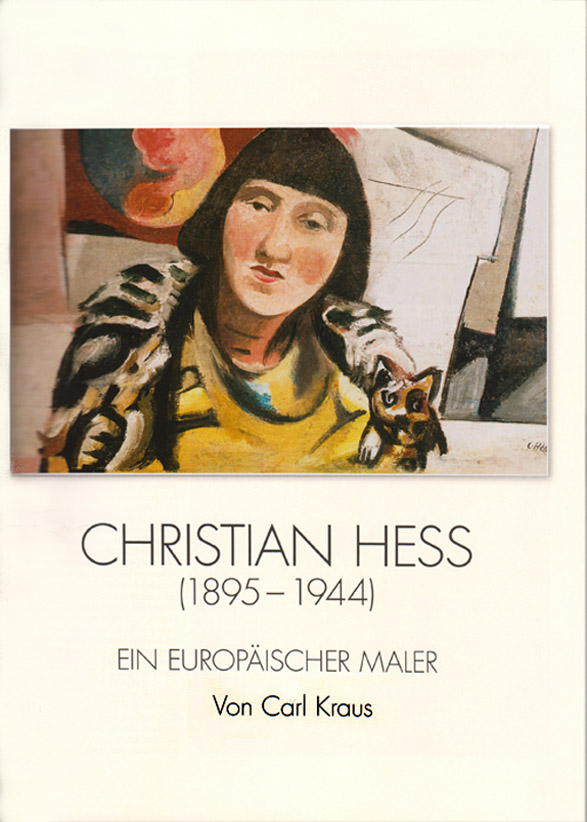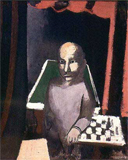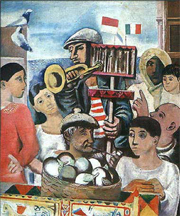|
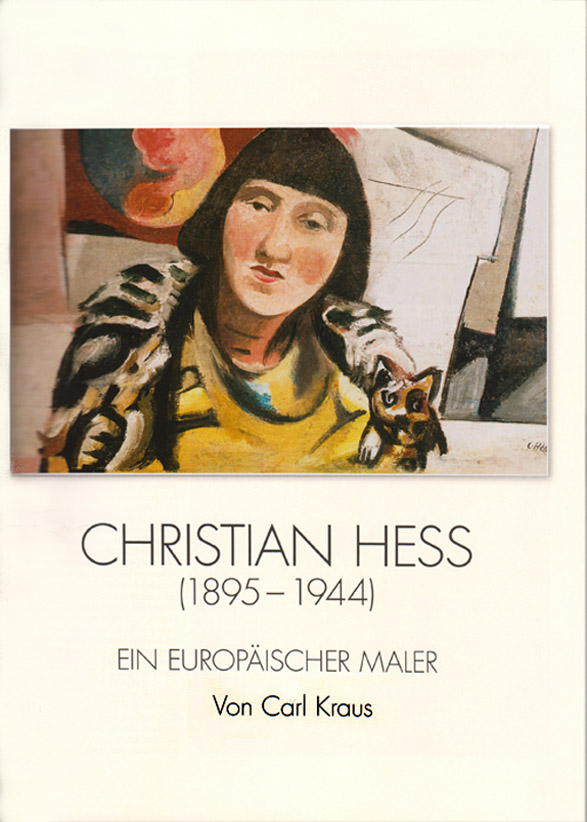
|
Dr.
CARL KRAUS, geboren 1959
in Sterzing, lebt als freier Kunsthis-
toriker in Innsbruck, tätig als Aus-stellungskurator
(zulezt u. a. "Friedrich Wasmann", Schloss Tirol
2006; "Alfons Walde", Turin 2006; "Auf den Spuren
von Maurice Denis. Symbolismus an den Grenzen des
Habsburger Reichs", Trient 2007), Autor, Gestalter
von Fern-sehdokumentationen und gerichtlich
beeideter Sachverständiger. |
Als
die vielbeachtete Wanderausstellung „Tiroler Künstler“ im
Sommer 1926 im Münchner Kunstverein ihren Abschluss fand,
stieß zu den bisherigen Ausstellern ein neuer Name hinzu:
Christian Hess. Neben Größen wie Egger-Lienz, Putz, Nikodem
und Walde konnte Hess, der erst zwei Jahre zuvor sein
Akademiestudium abgeschlossen hatte, freilich noch nicht
reüssieren. Wäre die Schau allerdings drei Jahre später
erfolgt, einer Zeit, in der der Maler bereits am Höhepunkt
seines Schaffens stand, hätte die Sache anders ausgesehen.
Aber da wäre Hess vermutlich nicht mehr sonderlich an der
Teilnahme einer Gemeinschaftsausstellung Tiroler Künstler,
die ihm großteils nicht auf der Höhe der Zeit erschienen,
interessiert gewesen.
Wie kein zweiter Zwischenkriegsmaler mit Tiroler Wurzeln war
Christian Hess international orientiert – biografisch
gesehen war München sein Mittelpunkt, seine zentrale
Inspirationsquelle Sizilien, die Schweiz ein weiterer
„Zufluchtsort“ – und seine Beziehungen während seiner
entscheidenden Schaffensjahre zum Kulturgeschehen in Tirol
waren praktisch nicht vorhanden. So wurde er dann auch, als
er 1940 in das mittlerweile zum „Gau“ mutierte Land seiner
Kindheit und Jugend zurückkehrte, mehr geduldet als
gefeiert. Nach dem Krieg wurden Werke „dieses
[inzwischen verstorbenen] koloristischen Talents“
noch einmal auf einer „Exportschau“ in München gezeigt. Dann
geriet der Maler wie zahlreiche andere Künstler der
„verlorenen Generation“ in völlige Vergessenheit.
Die Wiederentdeckung von Christian Hess erfolgte, von seiner
zweiten „Heimat“ Sizilien ausgehend, Mitte der 1970er Jahre.
Anlässlich seines dreißigsten Todestages stellte eine in
mehreren italienischen, deutschen und österreichischen
Städten gezeigte Gedächtnisschau erstmals sein Schaffen
umfassend vor. Zutage trat ein Künstler, „der die
europäische Kultur eingeatmet hat“, wie ihn der
Schriftsteller Leonardo Sciascia bezeichnete, einer auch,
der trotz oder gerade wegen der widrigen Zeitbedingungen ein
Werk von besonderer inhaltlicher und formaler Dichte schuf.
Kindheit, Schulzeit, Kriegsdienst
Tirol steht am Beginn und am Ende der Lebensgeschichte von
Christian Hess. Er wird am 24. Dezember 1895 als Sohn des
Dominicus und der Rosa Hess in Bozen geboren. Der
Vater
stammt aus Herlazhofen im Allgäu und arbeitet als
Kanzleibeamter, die Mutter kommt aus Oberösterreich. Zwei
Schwestern von Christian Hess sterben frühzeitig. Mit Emma,
der jüngsten, bleibt er hingegen sein Leben lang eng
verbunden. Sie ist es auch, die später mit großer Umsicht
seinen Nachlass betreuen wird.
1906 übersiedelt die Familie nach Innsbruck, wo Hess drei
Jahre später, nach dem Tod des Vaters, vom Gymnasium in die
Staatsgewerbeschule wechselt. Nach deren Abschluss 1913
absolviert er eine Lehre in der Tiroler Glasmalerei- und
Mosaikanstalt Mader, welche die ganze Welt mit ihren
dekorativen Produkten beliefert. Die weiteren beruflichen
Pläne werden zunächst durch den Kriegsausbruch verhindert.
Nachdem die Militärverwaltung seine Einberufung aufgrund der
familiären Verhältnisse zweimal aufschiebt, wird Hess 1916
doch zum Kriegsdienst eingezogen. Als deutscher Staatsbürger
einer bayerischen Pionierkompanie zugewiesen, kommt er an
die belgische und französische Front und nimmt u. a. an den
Schlachten bei Verdun, an der Somme und an der Aisne teil.
Von den Ungeheuerlichkeiten des modernen Massenkrieges ist
in seinen Skizzen und für das Heer gestalteten Postkarten
nichts zu spüren. Nie mehr werde er ein Gewehr in die Hand
nehmen, schreibt er aber später, – außer gegen Hitler (Brief
an die Schwester, Jahreswechsel 1934/35).
Akademiestudium in München
Im
Jänner 1919 nimmt Christian Hess sein Akademiestudium in
München auf, in einer Phase, in der die Stadt tiefgreifenden
gesellschaftspolitischen Spannungen unterworfen ist
(Revolution von 1918/19, Putschversuch
Hitlers
1923). Die folgenden stabileren Jahre bis zum Ausbruch der
Weltwirtschaftskrise 1929 sind dementsprechend kurz. Auch in
der Kunst gelten in München nicht die Zwanziger Jahre,
sondern jene von 1900 bis 1910 – mit dem „Blauen Reiter“ als
Kulminationspunkt – als das eigentliche „goldene“ Jahrzehnt
in diesem Jahrhundert. Franz Marc und August Macke sind wie
unzählige andere im Krieg gefallen, und Wassilij Kandinsky
kehrt nach 1918 nicht mehr nach München zurück, sondern
übersiedelt an das Bauhaus in Weimar bzw. Dessau. Die Neue
Sachlichkeit wiederum, die mit ihrem kühl-distanzierten
Blick auf die Wirklichkeit zu dem künstlerischen Ausdruck
der Zeit wird, besitzt in München zwar ein breites Forum,
mehrere ihrer Hauptvertreter, wie Alexander Kanoldt oder
Heinrich Maria Davringhausen, verlassen aber bald die Stadt
(und die wichtigsten, betont sozialkritischen neusachlichen
Maler, George Grosz und Otto Dix, arbeiten in Berlin und
Dresden).
Nichtsdestotrotz bietet die Kunststadt München um 1920 ein
vielfältiges Bild verschiedenster Strömungen, wobei
grundsätzlich das Pendel nach dem stürmischen Aufbruch zu
Jahrhundertbeginn nun mehr in Richtung Rückkehr zur
Tradition und zum Dinglichen ausschlägt. Die Akademie
versteht sich hingegen per definitionem eher als konservativ
und die meisten Professoren vertreten bestenfalls eine
gemäßigte Moderne, so auch der Leiter für Monumentalmalerei
Carl Johann Becker-Gundahl (1856–1925), in dessen Klasse
Hess eintritt. Zunächst zeittypischen, formal der
Freilichtmalerei verpflichteten „Armeleute“-Themen
zugewandt, tat sich Becker-Gundahl später vor allem durch
seine kirchlichen Wandbilder hervor, deren strenge
Stilisierung nach 1910 zuweilen expressiven Ansätzen weicht.
Für Hess und auch seine Mitschüler, zu denen u. a. die
späterhin bekannten Jean Egger (1918–22 bei Becker-Gundahl)
und Sergius Pauser (1920–24) zählen, bedeutet das
Akademiestudium eine erste Basis, mehr nicht. So verbindet
sich in seinem Frühwerk einerseits die unbefangene
Natursicht der Freilichtmalerei mit einer
gestisch-expressiven Auffassung, andererseits mit der
strengen Kompositionsweise Cézannes. Hess’ spezifische
Begabung für farbige Werte wird dabei bereits jetzt
deutlich: „Die Landschaftsaquarelle von Ch. Hess könnten
sich trotz ihrer Jugend schon in der Aquarell-Ausstellung
der Neuen Sezession sehen lassen“, schreibt ein
Rezensent anlässlich der ersten Präsentation des Malers in
München im März 1920. „Eine stille, heiße Liebe für die
Natur atmet aus ihnen und ein ungemein entwickelter
koloristischer Sinn.“ Das Kopieren nach Alten Meistern
wie Tizian, Veronese und Velasquez, mit dem er seine
wirtschaftliche Situation aufbessert, mag für ihn
diesbezüglich durchaus förderlich gewesen sein.
Schlüsselerlebnis Sizilien
Im
Frühjahr 1925 reist Hess erstmals nach Italien. Die erste
Station führt ihn nach Florenz, wo er in den Uffizien und im
Palazzo Pitti wiederum Gemälde der Alten Meistern kopiert.
Mit großen Erwartungen bricht er dann weiter nach Messina
auf, denn seine jüngere Schwester Emma, die seit kurzem in
der sizilianischen Hafenstadt verheiratet ist, hatte ihm
begeisterte Briefe von dort geschrieben. Und sie hatte ihm
nicht zuviel versprochen. Schon die ersten Eindrücke in
Sizilien erschließen dem Maler eine völlig neue Welt: mit
ihren in alten Traditionen eingebetteten Menschen, mit der
von antiken Mythen durchpulsten Landschaft, mit dem
unvergleichlichen mediterranen Licht. Dies sei das Paradies,
schreibt Hess seinen Künstlerfreunden nach Deutschland, und
wenngleich er nur langsam Äquivalente für sein
künstlerisches Erleben findet, weiß er, dass ihn dieses Land
nicht mehr loslassen wird. Auf Malexkursionen in die
Umgebung von Messina, nach Taormina, Monreale, Palermo und
die
antiken Stätten von Selinunt, Syrakus und Agrigent findet er
immer neue Impulse für sein Schaffen, fernab jedoch des dem
Pittoresken zugewandten touristischen Blickes. Damit reiht
sich Hess in eine lange Reihe deutscher Maler ein, die seit
dem frühen 19. Jahrhundert in Sizilien der „Harmonie von
Himmel, Meer und Erde“ (Johann Wolfgang von Goethe)
nachspürten.
Bereits im Dezember 1926 reist Christian Hess erneut nach
Messina, diesmal mit seiner langjährigen Lebensgefährtin,
der bekannten Münchner Sängerin Marya Neitzel. Im Herbst
1927 kommt der Maler wieder allein nach Sizilien, um hier
für mehrere Monate zu arbeiten. Nachdem er die Villa der
Industriellenfamilie Mayer in Wismar/Mecklenburg mit
sizilianisch inspirierten Wandbildern ausgestaltet hat,
kündigt er der Schwester im Sommer 1928 seinen nächsten
Aufenthalt hat an:
„Bestimmt fahre ich nach Girgenti u. Palermo.
Es wird fabelhaft! Also meine vielgeliebte -gesuchte
Badehose – va bene – sie wird noch passen. Certo. Ich bin
viel sicherer geworden in allem und werde mehr zuwege
bringen als das letzte Mal. Ich bin arbeitsfroh und lustig!
Sempre allegro! Freu mich schon auf das gute ital. Essen,
der Wirtshausfraß hier (jeden Abend Tiroler Gröstl für 30
Pfennig) behagt mir nicht.“
Als nach weiteren
Sommeraufenthalten 1929 und 1930 die Schwester ihre
Übersiedlung in einen anderen Ortsteil Messinas ankündigt,
schreibt der Maler voller Wehmut:
„Da du nun vielleicht doch die Wohnung auflöst, ist
einerseits ja sehr schade – d. h. meinetwegen, weil ich die
Terrazza so liebe und den schönen Blick aufs Meer u. nicht
zum Wenigstens, daß so viele schöne Erinnerungen an dort
verbrachte Stunden daranhängen. Ich wünsche Dir wahrhaftig
eine Villa, mit dem größten Komfort d. h. ein richtiges WC
mit echter Wasserspülung u. Bad. Aber mir ist so, als ob ich
meine Heimat verlieren würde, wenn Du aus der Palmara
wegzögst. War ja jetzt doch schon 5mal da und spielt dies
Milieu in meiner künstl. Entwicklung eine nicht
unbeträchtliche Rolle.“
Im Sommer 1931 reist Hess zusammen
mit dem Maler Adolf Hartmann und weiteren Freunden nach
Messina (im Winter ist er mit Josef Scharl in Rom). Längere
Aufenthalte folgen schließlich 1933/1934 – in diese Zeit
heiratet er hier die Schweizer Theologin und
Sozialarbeiterin Cecilia Faesy – und von 1935 bis 1938.
Bei den Münchner Juryfreien
Weitere entscheidende Momente im Künstlerleben von Christian
Hess fallen in die späten Zwanziger Jahre in München. Zum
einen treten Max Beckmann und Karl Hofer in sein näheres
Gesichtsfeld, die ihm in seiner Suche nach einer neuen
Konzentration der Form wichtige Impulse geben
(bezeichnenderweise widmet er sich nun verstärkt auch der
Plastik). „Er sucht das Vielfache in der Natur auf eine
einfache, starke malerische Ausdrucksform zu bringen“,
registriert die Kritik diese für den Maler richtungsweisende
Entwicklung und stellt dabei fest, dass er sich dadurch vom
„Zerfahrensein“ anderer Münchner Zeitgenossen
wohltuend abhebt. Der Vergleich des „Esels unter Kakteen“
von 1925 mit dem wenige Jahre später entstandenen „Widder
unter Kakteen“ macht die neue verfestigte,
plastisch-geschlossene Formensprache von Hess
augenscheinlich.
Zum anderen schließt sich Hess 1929 der Künstlervereinigung
„Die Juryfreien“ an, die bereits seit 1907 besteht, nun aber
neu belebt wird und sich als fortschrittlichste Münchner
Gruppierung in diesen Jahre positioniert. Neben den eigenen
Mitgliedern präsentieren die Juryfreien auch bedeutende
Informationsausstellungen, so z. B. über zeitgenössische
Architektur oder die „Ausstellung
Abstrakte und Surrealisten“ (1929) mit Werken u. a. von Hans
Arp, Willi Baumeister, Constantin Brancousi, Max Ernst, Paul
Klee, Konstantin Malewitsch, Juan Miró, Piet Mondrian, Pablo
Picasso und Gino Severini. Es spricht für die Offenheit von
Hess, dass sich in seinem Schaffen auch zu mehreren dieser
Künstler, im Besonderen zu Picasso, Bezüge finden.
Christian Hess kann sich innerhalb der Gruppe gleich
profilieren: „Die Juryfreien an der Prinzregentenstraße
formieren sich zusehends als vielversprechende (und
Verheißungen auch schon wahrmachende) Gruppe [...]
Ich notiere mir einstweilen Christian Hess, Josef Scharl,
auch Bock, Fritz Burkhardt, Graßmann, Panizza, Unseld,
von den Plastikern Spengler und Zeh“ (Wilhelm
Hausenstein, in: Kunstnotizbuch, Juli 1929). In der Folge
nimmt Hess regelmäßig an deren Ausstellungen teil,
insbesondere in München, aber u. a. auch in Düsseldorf,
Nürnberg, Leipzig, Danzig und Berlin. Für die Reputation des
Malers in dieser Zeit sprechen ebenso die wiederholte
Teilnahme an Ausstellungen der Münchner Secession im
Glaspalast (wo beim verheerenden Brand vom 6. Juni 1931 u.
a. auch mehrere seiner Werke vernichtet werden), der Auftrag
für Wandgemälde in der Heilbadeanstalt Oeynhausen
(Westfalen), der Ankauf eines Werkes durch die Städtische
Galerie im Lenbachhaus und das Heranziehen zweier seiner
Arbeiten als Titelbilder der bekannten Münchner Zeitschrift
„Jugend“. Dennoch muss er sich ständig mit Geldsorgen
herumschlagen, leben um 1930 in München doch an die 2.000
Künstler, die sich etablieren wollen.
Politik ist das große Thema
Als bei einer Versammlung des „Kampfbundes für deutsche
Kultur“ in München im März 1931 Christian Hess, Adolf
Hartmann, Günther Graßmann und Wolf Panizza von der SA
hinausgeworfen (und die beiden letzteren auch blutig
geschlagen) werden, wirkt dies wie ein böses Omen. „Die
Zustände in finanzieller Hinsicht waren noch nie so
katastrophal“, schreibt Hess im Juni 1932 an die
Schwester. „Wo man hinkommt u. wen man anspricht, alles
jammert über Geldmangel [durch die Weltwirtschaftskrise
ist die Arbeitslosigkeit in Deutschland auf 6,1 Millionen
angewachsen] und Politik ist das große Thema.“ Ein
gutes halbes Jahr später ist Hitler an der Macht und der
Führer selbst legt noch im selben Jahr in München den
Grundstein für das „Haus der Deutschen Kunst“ – während die
Juryfreien, deren Galerieräume genau gegenüberliegen, als
„kulturbolschewistische“ Vereinigung aufgelöst werden
(1934). Was deutsche Malerei zu sein hat, macht Hitler
spätestens in seiner Rede zur Eröffnung des Hauses der
Deutschen Kunst 1937 in unmissverständlicher Weise klar:
„Kubismus, Dadaismus, Futurismus, Impressionismus usw. haben
mit unserem deutschen Volke nichts zu tun. Denn alle diese
Begriffe sind weder alt noch sind sie modern, sondern sie
sind einfach das Gestammel von Menschen, denen die wahrhaft
künstlerische Begabung fehlt. Wir werden daher einen
unerbittlichen Säuberungskrieg führen gegen die letzten
Elemente unserer
Kulturzersetzung.“
Eine Umsetzung dieser Ankündigung ist die Schau „Entartete
Kunst“, in der die gesamte Moderne von Marc bis Kandinsky
und von Hofer bis Beckmann verfemt wird.
Bereits die Reise von Hess 1933 nach Sizilien kommt einer
Flucht gleich, um hier ohne Repressalien arbeiten zu können
(das faschistische Italien hegt gegenüber den modernen
Künstlern eine weit liberalere Haltung als das NS-Regime).
Um so mehr aber im Jahr 1935, als er gemeinsam mit seiner
Frau Cecilia samt Bildern und Hausrat nach Messina
übersiedelt. Durch die baldige Trennung von ihr und das
zunehmende Gefühl der Isolation – trotz der innigen
Beziehung zur Schwester und deren Familie – findet er jedoch
nicht mehr zum gewohnten Lebens- und Arbeitsrhythmus.
Schwere psychische Probleme bringen ihn bis an den Rand des
Selbstmords. So sieht er für sich keinen Ausweg, als
zunächst in die Schweiz (wo er sich bereits 1934/35 länger
aufgehalten hatte) und nach Ablauf der dortigen
dreimonatigen Aufenthaltsgenehmigung im Oktober 1938 nach
München zu ziehen.
Hier sucht er einige seiner alten Künstlerkollegen auf, die
z. T. von der Stadt auf die umliegenden Dörfer ausgewichen
sind. Andere trifft er nicht mehr an. Oskar Zeh, für dessen
Witwe Hess in Oberwössen ein Cafè mit Wandbildern dekoriert,
hatte sich 1935 erschossen. Josef Scharl, dessen von van
Gogh inspiriertes Bild „Mann am Fenster“ genauso wie Werke
von Hartmann und Graßmann (und u. a. auch von Putz und
Weber-Tyrol) in der Münchner Städtischen Galerie konfisziert
wurde, emigriert am Jahresende in die USA. Hess versucht
sich, so weit möglich, mit den neuen Verhältnissen zu
arrangieren, verlebt sogar eine kurze glückliche Zeit mit
einer jungen Frau, die gute Beziehungen zum Regime hat und
ihm Aufträge verschaffen kann. Auch erreicht er die Aufnahme
in die Reichskulturkammer, ohne die kein Künstler in
Deutschland arbeiten darf. Durch die Einberufung zum
Kriegsdienst bei der Reichspost sowie die akute
Verschlechterung seines Gesundheitszustandes kann Hess aber
schon bald nur mehr eingeschränkt seinem Schaffen nachgehen.
Rückkehr nach Tirol
Vom Kriegsdienst enthoben, zieht Hess im Dezember 1940 zu
Verwandten nach Axams bei Innsbruck. Nachdem er sich
gesundheitlich gut erholt, ist er „wieder ganz Tyroler
geworden und [...] sehr glücklich hier auf dem Land
u. in dem Gamsgebirg.“ Nur hat er Schulden, dass ihm
„die Haare zu Berge stehen“ (Brief an die Schwester, 7.
April 1941). So ist er gezwungen die verschiedensten
Auftragsarbeiten zu übernehmen, von Stammbäumen bis zu einer
Arbeit für das Propaganda-Amt, die am Bahnhofsplatz
aufgestellt wird. Die Situation wird für ihn etwas
erleichtert, als ihm von Max von Esterle, dem Landesleiter
der Tiroler Kunstkammer, ein Atelier in der Alten
Universität zugewiesen wird. An den „Gau-Kunstausstellungen
Tirol-Vorarlberg“ beteiligt er sich jedoch nur ein einziges
Mal, 1942 mit einer „Mythologischen Komposition“. Auch
strengt ihn die Arbeit durch die Verschlechterung seines
Tuberkuloseleidens zunehmend an. „Ich werde auch immer
grantiger u. alle Leut sind mir lästig mit ihrem Gequatsch.
Meine einzigen Freunde sind griech. Dichter und mein Viertel
Rotwein“ (Brief an die Schwester, 31. Juli 1942). Als er
dennoch einmal im Gasthaus seine Abneigung gegenüber dem
Regime kundtut, kann ihn nur die Fürsprache Esterles, der
allgemein um den Schutz der Künstler vor Übergriffen der
Politik bemüht ist, vor der Inhaftierung retten.
Als im Herbst 1944 regelmäßig die Bomben der Alliierten auf
Innsbruck fallen, ist Christian Hess „nie in einen
Luftschutzraum gegangen, er sagte immer, ‚wenn’s mich trifft
ist nicht viel hin’. So war auch es 2 x in der Meranerstr.,
1 x in der Werkstelle wo er arbeitete, am schwersten aber
bei uns Daheim in der Haspingerstr. [am 20. Oktober
1944]. Dort ist er im Garten im Liegestuhl gelegen als
das ganze Viertel um ihn in Trümmer ging, er ist fast könnte
man sagen wie ein Wunder herausgekommen. [...] Seit
dieser Zeit ist es aber rapid mit ihm
abwärst
gegangen, da der ganze Staub und die Glassplitter seiner
Lunge sehr schadeten“ (aus einem Brief von Hess’ Cousine
Paula, bei der der Maler in den letzten beiden Jahren
großteils lebt, 20. November 1947). Vier Tage nachdem
er in das Krankenhaus von Schwaz eingeliefert wird, stirbt
Christian Hess am 26. November 1944, kurz vor seinem 49.
Geburtstag. Ohne, dass die Öffentlichkeit davon Notiz
nimmt, wird er am Innsbrucker Westfriedhof begraben.
Ein europäischer Maler
Die künstlerische Gegenwelt zu dem von den Spannungen der
Zeit gezeichneten Leben Christian Hess’ ist eine auf
Ausgleich bedachte, nach klassischer Schönheit strebende,
hinter der aber die Erfahrung des Expressionismus stets
präsent bleibt. So zieht sich das Gefühl des Geworfensein
und die sich daraus ergebende Melancholie wie ein roter
Faden durch das Werk, in besonders direkter Weise etwa im
großartigen „Schachspieler“, bei dem die Figur halb
gelassen, halb resignierend zwischen Schachspiel und dem
perspektivisch verzerrten Billardtisch eingespannt erscheint
– im großen Spiel der Politik ist der Mensch eine kleine
Figur, die der Willkür der Spieler ausgesetzt ist. Manches
in dem Bild wie auch in anderen erinnert an Beckmann (z. B.
an dessen „Selbstbildnis mit Saxophon“ von 1930): die groß
gesehene plastische Form mit ihren schwarzen Konturen und
kräftigen Licht-Schatten-Kontrasten, die freie malerische
Modulierung, in der Schwarz und Weiß grundlegende Farbwerte
darstellen, die magische Ding- und Raumwirkung. Bei Hess
bleibt jedoch alles mehr „peinture“, stilllebenhafter, und
statt der visionären
Metaphorik
Beckmanns zeugen seine Bilder zumeist von der Sehnsucht nach
klassischer Idealität. Damit steht der Maler Karl Hofer und
den Künstlern der Valori Plastici näher als Beckmann.
Modelle, Liegende und Badende gehören bezeichnender Weise
mit zum bevorzugten Inventar der Hess’schen Bilderwelt,
umgesetzt in einen nuancenreichen Kolorismus mit zuweilen
eigenwilligen Akkorden zwischen Rosa, Violett und einem
spezifischen grünlichen Gelb. So erkennt man in den in einen
kubistischen Hintergrund eingebetteten „Drei Modellen“
zugleich junge modische Frauen der Zwanziger/Dreißiger Jahre
als auch die Drei Grazien der Antike.
Den großen Widerschein zeitloser Klassizität findet Hess
aber in Sizilien. Fischer, Matrosen und Bauern bei der seit
Jahrhunderten unverändert gebliebenen Arbeit, Wahrsager und
Frauen am Meer, die mythisch empfundene Landschaft regen ihn
zu einer Vielzahl an Bildschöpfungen an. Geprägt von
plastisch-tektonischer Bildstruktur und verhaltener
Feierlichkeit, kommen sie mitunter den Werken eines Carrà
und Casorati nahe. Zu diesen klassisch-italienischen
Kompositionen zählen die “Tauben auf der Terrasse“, die mit
ihrer Friedenssymbolik nicht zufällig im Jahr 1933
entstehen.
Die intensive Auseinandersetzung mit den reinen Form- und
Farbwerten hat Hess in den Dreißiger Jahren auch zu
Städtebildern und Stillleben mit hohem Abstraktionsgrad
geführt: die in die Fläche projizierten kubischen Häuser
eines sizilianischen Ortes mit dem farbigen Dreiklang
Rostrot-Schwarz-Weiß etwa oder das gleichfalls kubistisch
angelegte, mit vereinfachten Naturformen und Schriftzeichen
spielende “Stillleben mit La Gazzetta“. Mit der sonstigen
Tiroler Malerei der Zeit wenig gemein, unterstreichen sie
den europäischen Zuschnitt des Malers.
Für die großzügige Unterstützung und Bereitstellung von
Dokumentationsmaterial
danke
ich den Nichten des Künstlers Luisa Ardizzone (Rom) und
Antonia Cinquegrani (Messina) mit Familien sowie Frau
Leonore Neitzel (München) herzlich.
Der Arbeiten von Domenico M. Ardizzone, Nuccio Cinquegrani
und der Associazione Culturale Christian Hess bildeten
wichtige Grundlagen für die Bearbeitung dieses Beitrages.
|
|
|
|
|

Modell im
Atelier, um 1932, Öl auf Leinwand, 44 x 70 cm,
Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck |

Esel unter Kakteen, 1925,
Öl auf Leinwand,
55 x 80,5 cm, Privatbesitz |

Boote am Strand, 1932,
Öl
auf Leinwand, 79 x 98 cm, Privatbesitz, courtesy
Bozner Kunstauktionen |

Schlafendes Mädchen auf gelbem Kissen, um 1930,
Öl auf Leinwand , 84 x 101 cm Bozen, Museion
|
|
|
|
|
|
|

Widder unter Kakteen, um
1930,
Öl auf Leinwand,
100 x 80 cm, Bozen, Museion |
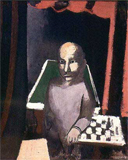
Der
Schachspieler, 1931, Öl auf Leinwand , 94 x 74
cm, Bozen, Museion |

Knabenbildnis, um 1926,
Terrakotta, Höhe 30 cm, Privatbesitz, courtesy
Galerie Maier, Innsbruck |

Drei
Modelle, um 1932, Öl
auf Leinwand, 59 x 93 cm, Privatbesitz |
|
|
|
|
|
|

Bracciano, wohl um 1932, Öl auf Leinwand, 60 x
69 cm, Privatbesitz |

Rot-schwarze
Hauser, wohl um 1933, Öl auf Leinwand, 58 x 68
cm, Bozen, Museion |

Stillleben mit La
Gazzetta, 1933, Öl auf Leinwand, 58 x 77 cm,
Privatbesitz |

Fische,
1937, Thsche, 26,5 x 34,2 cm, Privatbesitz
|
|
|
|
|

Tauben auf
der Terrasse, 1933, Öl auf Leinwand, 60 x 80
cm, Privatbesitz |
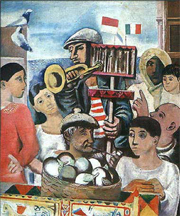
Wahrsager,
1933, Öl auf Leinwand, 120 x 100 cm,
Privatbesitz |

Christian Hess 1929 |

Stürzender Torso, um 1930,
Öl auf Leinwand , 68 x 95 cm,
Privatbesitz |
|
|
|
|

Zwei
Modelle, um 1932, Öl auf Leinwand , 63 x 48
cm, Privatbesitz, courtesy
Galerie Maier, Innsbruck |

Monreale, 1928, Öl auf Karton, 27 x 39 cm,
Museum Rabalderhaus, Schwaz |

Selbstbildnis, um 1935/40,
Rötel, 41,4 x 31 cm,
Privatbesitz, courtesy
Galerie Maier, Innsbruck |
|
|
|
|
Biografische Daten
1895 - Alois Anton Dominicus Hess (auch Heß), der sich
später Louis Christian bzw. nur Christian Hess nennt, wird
am 24. Dezember in Bozen als Sohn des aus dem Allgäu
stammenden Beamten Dominicus Hess und seiner Frau Rosa geb.
Mayer geboren. Er hat noch drei Schwestern: Berta
(1893–1915), Rosa (1899 - 1905) und Emma (1902–1973).
1906 - Übersiedlung mit der Familie nach Innsbruck.
1909 - Nach dem Tod des Vaters Wechsel vom Gymnasium auf die
Staatsgewerbeschule in Innsbruck (Prof. Heinrich Comploj).
1913 - Nach dem Schulabschluss Lehre in der Tiroler
Glasmalerei- und Mosaikanstalt Mader, zeitweise auch in der
Keramikwerkstätte Kuntner in Bruneck.
1916 - 18 Zum Kriegsdienst eingezogen; kommt als deutscher
Staatsbürger mit der bayerischen Pionierkompanie Nr. 3 an
die belgische und französische Front.
1919 - Ab Jänner Studium an der Münchner Akademie bei Carl
Johann Becker-Gundahl. Zu seinen Studienfreunden zählen die
Maler Florian Bosch, Franz Gebhardt, Adolf Hartmann und
Siegfried Kühnel sowie der Bildhauer Benno Miller.
1920 - Beteiligung an der „Ausstellung junger Münchner“.
1921 - Mit einem Stipendium Reise nach Skandinavien.
1922 - Erste von mehreren Reisen nach Wien um Werke Alter
Meister zu kopieren.
1924 - Akademieabschluss; erhält mehrere Porträtaufträge.
1925 - Reise über Florenz nach Messina, wo seine Schwester
Emma lebt. Sizilien wird für Hess in der Folge zur zentralen
Inspirationsquelle.
1926 - Erstmals an einer Ausstellung der Münchner Secession
beteiligt, Teilnahme auch an der Ausstellung „Tiroler
Künstler“ in München. Wendet sich ab dieser Zeit verstärkt
auch der Plastik zu. Lebensgemeinschaft mit der Sängerin
Marya Neitzel, mit der er im Dezember nach Messina reist.
1927 - Viermonatiger Sizilien-Aufenthalt.
1928 - Lernt Max Beckmann kennen, der ihm wichtige
Schaffensimpulse gibt. Fresken in der Villa des
Industriellen Mayer in Wismar (Mecklenburg);
Ausstellungsbeteiligung in Berlin; erneut in Sizilien.
1929 - Tritt der progressiven Münchner Künstlervereinigung
„Die Juryfreien“ bei, mit der er in der Folge regelmäßig
ausstellt. Hess kann sich neben Günther Graßmann, Adolf
Hartmann, und Josef Scharl als eines der führenden
Mitglieder etablieren; Sommeraufenthalt in Sizilien.
1930 - Wandgemälde in der Heilbadeanstalt in Bad Oeynhausen
(Westfalen). Verkauf eines Gemäldes auf Vermittlung von Karl
Hofer nach Zürich; lernt in der Schweiz die Theologin und
Sozialarbeiterin Cecilia Faesy kennen, die hier für ihn zur
Vermittlerin von Werken wird; Sommeraufenthalt in Sizilien.
1931 - Beim Brand des Münchner Glaspalastes am 6. Juni, bei
dem 3.000 Kunstwerke ein Raub der Flammen werden, wird u. a.
Hess’ Triptychon “Am Wasser“ vernichtet.
Ausstellungsbeteiligungen in Nürnberg, Danzig und
Königsberg. Im Sommer zusammen mit Adolf Hartmann in
Sizilien, im Dezember mit Josef Scharl in Rom.
1932 - Ausstellungsbeteiligungen u. a. in München,
Düsseldorf, Nürnberg, Danzig und Leipzig. Im Ausschuss der
Juryfreien.
1933 - Die restriktiven kulturpolitischen Verhältnisse nach
der Machtübernahme Hitlers lassen Hess im Sommer nach
Messina übersiedeln.
1934 - Im August Heirat mit Cecilia Faesy, mit der er
anschließend nach Luzern zieht. Die als
“kulturbolschewistisch“ eingestuften Juryfreien werden in
München aufgelöst.
1935 - Im März Übersiedlung nach Messina zusammen mit seiner
Frau, die sich aber noch im Winter dieses Jahres von ihm
trennt.
1938 - Im Mai Rückkehr in die Schweiz, wo er eine Zeitlang
beim jungen Maler und Kunstschriftsteller Jürg Spiller in
Liestal Unterkunft findet; im Oktober Rückkehr nach München.
1939 - Zum Kriegsdienst eingezogen und der Reichspost
zugewiesen.
1940 - Erreicht im Jänner die Aufnahme in die
Reichskulturkammer. Nach einer schweren Lungenerkrankung
Einlieferung in das Krankenhaus Schwabing, später in die
Heilanstalt Planegg. Aus dem Kriegsdienst entlassen, zieht
Hess im Dezember zu Verwandten nach Axams bei Innsbruck.
1941 - Wohnt in einem Gasthaus in Grinzens. Verschlechterung
des Gesundheitszustandes.
1942 - Von Max von Esterle, dem Landesleiter der Kammer der
bildenden Künste in Tirol-Vorarlberg, wird ihm ein Atelier
in Innsbruck zugewiesen. Auftrag für Wandbilder im Rathaus
von Zirl (nicht erhalten); Teilnahme an der 3.
Gau-Kunstausstellung in Innsbruck mit einer “Mythologischen
Komposition“.
1943 - Wohnt ab dieser Zeit großteils bei seiner Cousine
Paula Hess in Innsbruck.
1944 - Stirbt am 26. November im Krankenhaus von Schwaz,
nachdem der Staub der Bomben auf Innsbruck sein
Tuberkuloseleiden zusätzlich verschlechtert hatte.
Literatur (Auswahl)
Zweijahrbuch 1929/30 deutscher Künstlerverband die
Juryfreien München, mit Beiträgen von H. Eckstein, O. M.
Graf, W. Petzet und F. Roh, München 1930;
Christian Hess, Ausstellungskatalog, mit Beiträgen von D. M.
Ardizzone, N. Cinquegrani, H. Eckstein und M. Venturoli,
Palermo 1974;
Christian Hess, Ausstellungskatalog, bearbeitet von G.
Ammann, Innsbruck 1976;
Österreichs Avantgarde 1900–1938. Ein unbekannter Aspekt,
Ausstellungskatalog, bearbeitet von O. Oberhuber und P.
Weibel, Wien-Innsbruck 1976;
Die Zwanziger Jahre in München, Ausstellungskatalog,
herausgegeben von Ch. Stölzl, München 1979;
Abbild und Emotion. Österreichischer Realismus 1914–1944,
Ausstellungskatalog, mit Beiträgen von W. Drechsler, G.
Koller, O. Oberhuber, O. Sandner und M. Wagner, Wien-Bregenz
1984;
Expression – Sachlichkeit. Aspekte der Kunst der 20er und
30er Jahre Tirol-Südtirol-Trentino, Ausstellungskatalog, mit
Beiträgen von G. Ammann, G. Belli, A. Hapkemeyer, S. Hirn,
C. Kraus und P. L. Siena, Innsbruck-Trient-Bozen 1994/95;
C. Kraus, Zwischen den Zeiten. Malerei und Graphik in Tirol
1918–1945, Lana-Bozen 1999;
N. Cinquegrani, Pitture
come poesie / Gemalte Gedichte. Colloquio immaginario con
Christian Hess e i suoi personaggi, Messina 2003;
P. Naredi-Rainer / L. Madersbacher (Hrsg.),
Kunst in Tirol, 2 Bände, Innsbruck 2007; Im Spiegel der
Wirklichkeit, Ausstellungskatalog, Einführung von M. Boeckl,
Bruneck 2007; Christian Hess, Ausstellungskatalog,
bearbeitet von C. Kraus, Schwaz-Bozen 2008/09
Homepages im Internet
www.christian-hess.net
www.louis-christian-hess.com
|